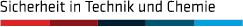Besondere Anforderungen an die Werkstoffe von Gefahrgutverpackungen
Besonderheiten bei Flüssigkeits-Verpackungen aus Kunststoff
Gemäß ADR, Unterabschnitt 4.1.1.2 a) dürfen Teile von Verpackungen, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, die unmittelbar mit den gefährlichen Gütern in Berührung kommen, nicht durch diese angegriffen oder erheblich geschwächt werden.
Diese Forderungen bezieht sich auf alle Bestandteile der Verpackungen, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen. Damit sind neben dem Umschließungskörper auch z. B. Verschlussmittel wie Deckel, Spundstopfen, Entnahmeeinrichtungen, Auslaufarmarturen und Dichtungen eingeschlossen.
Anders als bei Verpackungen aus Metall, Holz, Pappe, Gewebe, Papier oder Steinzeug, bei denen die Erfüllung dieser Forderung beim Versender liegt, wird für Flüssigkeits-Verpackungen aus Kunststoff der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gefordert.
Der einfachste Nachweis erfolgt dabei mittels einer 6-monatigen Vorlagerung mit dem vorgesehenen Original-Füllgut und der darauffolgenden (erfolgreichen) Baumusterprüfung. Da die Vorlagerung/Prüfung im versandfertigen Zustand der Verpackung erfolgen muss, ist auch der Nachweis der Verträglichkeit gegenüber allen füllgutberührenden Anbauteilen erbracht worden.
Bei Verpackungen, einschließlich Großpackmittel, die aus Polyethylen bestehen, kann die Verträglichkeit mittels Standardflüssigkeiten (Wasser, Netzmittellösung, Essigsäure, n-Butylacetat/mit, n-Butylacetat gesättigte Netzmittellösung, Kohlenwasserstoffgemisch und Salpetersäure) nachgewiesen werden (Details siehe unten). Für Gefahrgüter, die hinsichtlich ihrer Schädigungswirkung diesen Standardflüssigkeiten zugeordnet werden können (s. Assimilierungsverfahren und Assimilierungsliste in ADR 4.1.1.21) gilt der Nachweis als erbracht, sofern die Anforderungen an die zugelassene Verpackung (Dichte, Dampfdruck, Verpackungsgruppe) mit der betroffenen Standardflüssigkeit erfüllt wurden.
Zu beachten ist hierbei, dass dieser Nachweis der chemischen Verträglichkeit sich nur auf den Umschließungskörper beziehen kann. Für die Anbauteile, die aus einem anderen Material als Polyethylen bestehen, besteht diese Möglichkeit der Assimilierung nicht. Hier ist der Versender eigenverantwortlich gefordert die Verträglichkeit von Füllgut mit den Verpackungsmaterialien sicherzustellen.
Als Beispiel wären elektrisch ableitende IBC zu nennen, bei denen die Ableitung in der Auslaufarmatur mittels einer Metallschraube erfolgt. Diese IBC sollten nicht für oxidierende Füllgüter eingesetzt werden, auch wenn dies über die Standardflüssigkeiten als abgedeckt erscheint.
Besonderheiten bei Verpackungen aus Polyethylen
Bei den am häufigsten eingesetzten Kunststoffen – hoch- und mittelmolekulares hochdichtes Polyethylen (HMW HDPE und MMW HDPE) – kann im Regelfall die halbjährige Vorlagerung durch eine auf drei Wochen verkürzte Vorlagerung bei 40°C ersetzt werden. Der Nachweis erfolgt hierbei in der Regel mit sogenannten Standardflüssigkeiten, die als Repräsentanten der verschiedenen Schädigungswirkungen (Anquellen, Spannungsrissbildung, molekularer Abbau und Kombinationen hiervon) gegenüber dem Polyethylen dienen. Diesen Schädigungsmechanismen wurden jeweils Standardflüssigkeiten zugeordnet (siehe ADR 6.1.6.1):
(...)
a) Netzmittellösung für auf Polyethylen stark spannungsrissauslösend wirkende Stoffe, insbesondere für alle netzmittelhaltigen Lösungen und Zubereitungen.
(...)
b) Essigsäure für auf Polyethylen spannungsrissauslösend wirkende Stoffe und Zubereitungen, insbesondere für Monocarbonsäuren und einwertige Alkohole.
(...)
c) n-Butylacetat / mit n-Butylacetat gesättigte Netzmittellösung für Stoffe und Zubereitungen, welche Polyethylen bis zu etwa 4 % Masseaufnahme anquellen und gleichzeitig spannungsrissauslösende Wirkung zeigen, insbesondere für Pflanzenschutzmittel, Flüssigfarben und gewisse Ester.
(...)
d) Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) für auf Polyethylen quellend wirkende Stoffe und Zubereitungen, insbesondere für Kohlenwasserstoffe, gewisse Ester und Ketone.
(...)
e) Salpetersäure für alle Stoffe und Zubereitungen, die auf Polyethylen gleich oder geringer oxidierend einwirken oder die molare Masse abbauen als eine 55 %ige Salpetersäure. Verwendet wird Salpetersäure in einer Konzentration von mindestens 55 %.
(...)
f) Wasser für Stoffe, die Polyethylen nicht wie in den unter a) bis e) genannten Fällen angreifen, insbesondere für anorganische Säuren und Laugen, wässerige Salzlösungen, mehrwertige Alkohole, organische Stoffe in wässeriger Lösung.
(...)
Diesen Standardflüssigkeiten können die in dem Stoffverzeichnis ("Assimilierungsliste") in Unterabschnitt 4.1.1.19 des ADR/RID zusammengefassten Gefahrgüter vom Verwender ohne weitere Nachweise zugeordnet werden.
Die BAM hat diese Zuordnungen von Gefahrgütern zu Standardflüssigkeiten in einer fortgeschriebenen Assimilierungsliste (BAM-GGR 004, Anhang 1 ) in der Gefahrgutregel BAM-GGR 004 veröffentlicht, die laufend an den fortgeschrittenen Stand des Wissens angepasst werden soll. Hierzu hat die BAM eine Arbeitsgruppe eingerichtet.
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit für andere Füllgüter bei Vorliegen einer Bauartprüfung mit einer oder mehreren Standardflüssigkeiten kann über Laborprüfungen erfolgen. Hierbei werden Proben des gleichen Formstoffes vergleichenden Werkstoffprüfungen (keine komplette Bauartprüfung ist notwendig) mit einer Standardflüssigkeit und einem Füllgut X unterworfen, um nachzuweisen, dass das Füllgut X den Werkstoff weniger schädigt als die Standardflüssigkeit.
Um die Schädigungswirkungen dieser anderen Füllgüter gegenüber Polyethylen im Vergleich zu den Standardflüssigkeiten bewerten zu können, wurden die "Prüfvorschriften für Kunststoffgefäße", die sogenannten "Labormethoden" entwickelt. Man findet sie entweder im RID als Anhang an Kapitel 6.1 oder als Norm EN ISO 16101 "Verpackung - Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter - Verträglichkeitsprüfung für Kunststoffverpackungen (ISO 16101:2004)".
Mittels Labormethode A wird die Masseaufnahme durch Anquellung untersucht. Labormethode B ist ein Stifteindrückverfahren, und untersucht die Spannungsrißbildung. Labormethode C dient zur Ermittlung einer möglichen oxidativen oder molekular abbauenden Schädigung des Werkstoffs Polyethylen. Dabei wird der Schmelzindex nach Vorlagerung mit Füllgut bestimmt und mit dem bei Vorlagerung mit 55%iger Salpetersäure verglichen.
Zur chemischen Beständigkeit der ansonsten überwiegend im Tankbau verwendeten metallenen Werkstoffe und von Dichtungswerkstoffen hat die BAM die sogenannte BAM-Liste erstellt, die regelmäßig erweitert und an den neuesten Stand der Technik angepasst wird. Sie kann – soweit zutreffend – auch für Verpackungen genutzt werden.
Eine Übertragung der für einen Kunststoff als Formstoff gewonnenen Erkenntnisse auf andere Formstoffe ist ebenfalls in bestimmten Fällen durch vergleichende Laborprüfungen möglich. Dieses Verfahren wird in der Gefahrgutregel BAM-GGR 003 beschrieben (siehe Eignungsnachweis alternativer Kunststoff-Formstoffe).